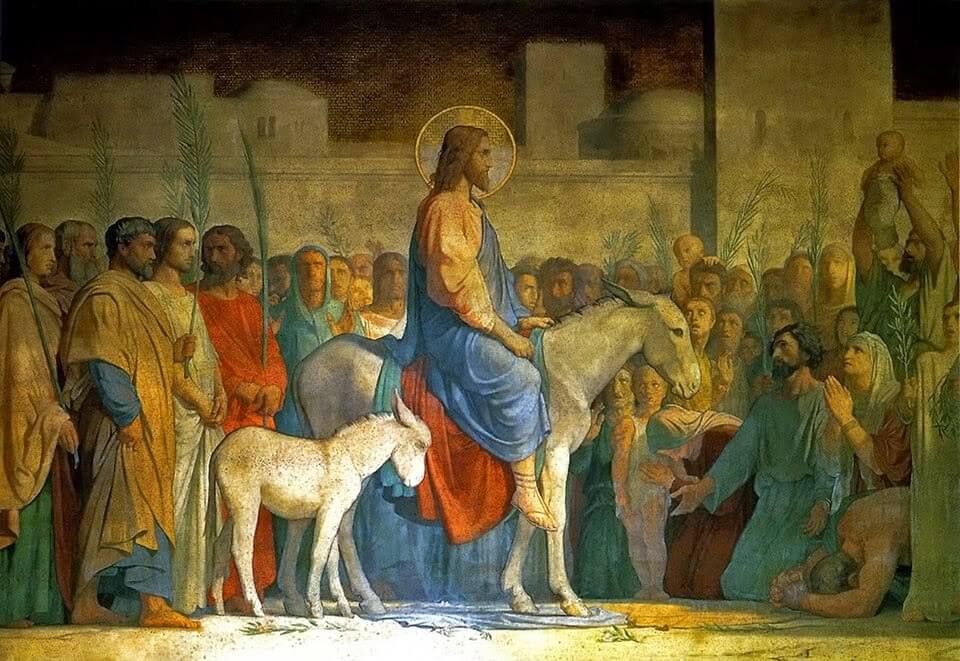… esst und trinkt den neuen Bund – gedenkt des Herrn bis dass er wiederkommt!
Der Name kommt von „gronan“ – weinen, klagen.
An diesem Tag wurden in der frühen Kirche die Büßenden, die am Aschermittwoch von der Teilnahme am Gottesdienst ausgeschlossen worden waren, wieder in die Gottesdienst-gemeinschaft aufgenommen.
An diesem Tag fliegen die Glocken nach Rom – sie werden zum Gloria geläutet und schweigen bis zur Osternacht.
In der Liturgie, aber auch außerhalb wurden an diesen Tagen Ratschen verwendet.
Mit dem Gottesdienst beginnt die Feier der drei großen Tage, des Höhepunktes unseres Glaubens. Eigentlich sind die Gottesdienste als eine große Feier zu verstehen, die ihren Beginn hat in der Einsetzung des Abendmahles und endet mit dem Höhepunkt, der Auferstehung Jesu.
Ubi Caritas – Wo die Güte und die Liebe wohnt
Ein markantes Ereignis in der Liturgie ist die Fußwaschung. Der Priester vollzieht an 12 Personen das nach, was Christus selbst am Abend des letzten Abendmahles an seinen Jüngern vollzogen hat. Dabei hat auch dieser Ritus eine große Wandlungsgeschichte: in der Westkirche begegnet uns diese Handlung schon ab dem 4. Jahrhundert in der Taufliturgie. Die heute übliche Form und der übliche Zeitpunkt sind erst seit der Neuordnung der Karwochenliturgie 1955 in Kraft. Verbindlich vorgeschrieben ist die Fußwaschung nur für Bischofs- und Abteikirchen.
Im Mittelalter hatten die regierenden Fürsten diesen Brauch übernommen, in England ist dies im frühen 13. Jh. belegt. Verbunden war die Fußwaschung mit einer Gabe von Speise und Kleidern. Im 14. Jahrhundert erhöhte sich die Zahl derer, denen die Füße gewaschen wurden auf die Anzahl der Lebensjahre des Monarchen, dann kamen noch gleichviele Frauen dazu. Zwischenzeitlich wurde dann der Brauch an den Almosenverwalter übergeben, aber 1932 durch König Georg V. wiederaufgenommen.
Bleibet hier und wachet mit mir
Nach der Eucharistiefeier wird der Altar seines Schmuckes beraubt, die Altartücher werden fortgenommen, der Tabernakel geöffnet.
So steht der Altar, das Sinnbild Christi, zur Erinnerung an das Leiden des Herrn nackt und bloß in der Kirche.
Gründonnerstag hieß auch Antlasstag – das kommt von Ablass: die Büßenden wurden wieder aufgenommen, wie schon vorher erwähnt, so wurden die am Gründonnerstag gelegten Eier auch Antlasseier genannt und galten als besonders heilkräftig und wurden für die Eier und Speisenweihe aufgehoben. Andererseits wurden sie auch zum Bezahlen von Schulden und Abgaben verwendet.